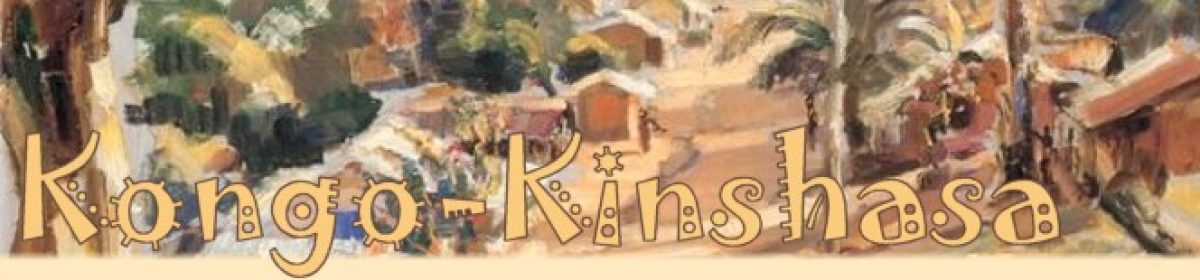Der zweite Entwurf des Friedensabkommens zwischen Kinshasa und Kigali
Delegierte aus der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda werden diese Woche erneut in Washington erwartet. Ziel ist es, die Friedensverhandlungen zwischen den beiden Ländern fortzusetzen.
Der von RFI eingesehene Text geht über die im vergangenen April in Washington von den kongolesischen und ruandischen Außenministern unterzeichnete Grundsatzerklärung hinaus. Demnach ist die Unterzeichnung des Friedensabkommens in erster Linie an den bedingungslosen Rückzug Ruandas aus kongolesischem Gebiet geknüpft. Dies gilt auch für Waffen und Ausrüstung unter ruandischer Kontrolle, mit Ausnahme der im Gemeinsamen Sicherheitskoordinationsmechanismus ausdrücklich vorgesehenen Fälle. Unseren Informationen zufolge wurde dieser Punkt bereits in den kongolesischen Vorschlägen angesprochen, die zum ersten Entwurf führten. Das Problem: Kigali hat die Präsenz seiner Streitkräfte in der Demokratischen Republik Kongo nie eingeräumt. Die ruandische Regierung spricht stattdessen von „Verteidigungsmaßnahmen“, die zu ihrer eigenen Sicherheit ergriffen wurden.
Zweite Bedingung: die Aufhebung des Belagerungszustands in Nord-Kivu. Dieser Ausnahmezustand, der wie in Ituri seit 2021 in Kraft ist, muss einer zivilen Verwaltung weichen, damit der Prozess voranschreiten kann. Das Dokument erwähnt auch das Waffenstillstandsabkommen zwischen Kinshasa und der M23, das noch in Doha verhandelt wird. Die Logik ist klar: Das Abkommen mit Ruanda kann erst nach Abschluss des Abkommens zwischen Kinshasa und der AFC/M23 unterzeichnet werden.
Der Abkommensentwurf befasst sich auch mit der Frage der Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR). Beide Länder müssen „nach bestem Wissen und Gewissen zusammenarbeiten, um bewaffnete Elemente der FDLR zu identifizieren, zu bewerten, zu lokalisieren und zu beseitigen“. Diese Zusammenarbeit ist Teil des Rahmens und entspricht den Bedingungen des im Oktober 2024 in Luanda vereinbarten Operationskonzepts. Der Text sieht schließlich vor, dass die Demokratische Republik Kongo jegliche materielle oder finanzielle Unterstützung der FDLR, egal ob national oder aus dem Ausland, verbieten und unterbinden wird.
Wenn das Dokument unterzeichnet wird, gelten die Verpflichtungen für das gesamte Land, auch wenn Nord- und Südkivu weiterhin im Mittelpunkt stehen. Es handelt sich jedoch nur um einen Entwurf. Die eigentliche Verhandlungsarbeit beginnt diese Woche. Sie könnte zu einem Ministertreffen führen, bevor eine mögliche Unterzeichnung durch die Präsidenten der DR Kongo und Ruandas erfolgt
(www.rfi.fr)
Tshopo: Plädoyer für die Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofs für die DR Kongo
Die Bevölkerung der Provinz Tshopo fordert die Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofs, um die Verantwortlichen für die während der verschiedenen Kriege im Osten der Demokratischen Republik Kongo begangenen Verbrechen zu verfolgen. Diese Forderung wurde am Dienstag, den 10. Juni, zum Abschluss der Gedenkveranstaltungen zum Sechstagekrieg in Kisangani geäußert, die vom Fonds für Wiedergutmachung und Entschädigung für illegale Aktivitäten Ugandas in der Demokratischen Republik Kongo (FRIVAO) organisiert wurden.
FRIVAO-Sekretär und Berichterstatter Clémence Kalibundji betonte, dass mehrere Akteure, sowohl kongolesische als auch ausländische, an der Gewalt beteiligt waren, die die Demokratische Republik Kongo blutig getroffen hat. Er ist der Ansicht, dass Schritte unternommen werden müssen, um sicherzustellen, dass bestimmte Parteien zur Rechenschaft gezogen werden, insbesondere Ruanda, dem vorgeworfen wird, auf kongolesischem Boden, insbesondere in Kisangani, Verbrechen begangen zu haben. „Es muss Lobbyarbeit bei anderen Behörden geleistet werden, um sicherzustellen, dass die Verantwortung für die Verbrechen anerkannt und Wiedergutmachung geleistet wird“, erklärte er.
Während die FRIVAO auf Fortschritte bei der Errichtung eines Strafgerichtshofs wartet, setzt sie ihre Bemühungen um die Entschädigung der Konfliktopfer fort. Von den 14.818 identifizierten Opfern haben 14.109 bereits eine individuelle Entschädigung erhalten. Dieser Appell für Gerechtigkeit könnte einen Wendepunkt in der Anerkennung von Verbrechen und Wiedergutmachung in der Demokratischen Republik Kongo markieren, während die Erinnerung an die Konflikte in der Provinz Tshopo noch immer lebendig ist, betonen Beobachter.
Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses
Professor Jean Malonga von der Fakultät für Politik-, Sozial- und Verwaltungswissenschaften der Universität Kisangani betont, wie wichtig es ist, das kollektive Gedächtnis der Konflikte zu bewahren, die die Stadt geprägt haben: den Ein-Tage-, Drei-Tage- und Sechs-Tage-Krieg. „Das kollektive Gedächtnis muss durch das Schreiben von Büchern und Artikeln sowie durch die Weitergabe dieser Geschichten an jüngere Generationen, sei es in der Schule oder zu Hause, bewahrt werden“, sagte der Wissenschaftler
(www.radiookapi.net)
Fall Chebeya: Oberst Mukalay fordert seine Freilassung nach Verbüßung seiner Strafe
Oberst Daniel Mukalayi verbüßt seit dem 4. Juni seine 15-jährige Haftstrafe. Als einer der im Chebeya- und Bazana-Prozess Verurteilten fordert er seine Freilassung.
Oberst Daniel Mukalayis Inhaftierung sei willkürlich geworden, so sein Anwalt Stéphane Kezza. Er berichtet, dass die Generalstaatsanwaltschaft (Auditorat Général) den Nationalen Sicherheitsrat, der seinen Mandanten seit dem 4. Juni 2010 inhaftiert hatte, schriftlich aufgefordert habe, die Rechtsgrundlage für diese Inhaftierung zu klären und alle notwendigen rechtlichen Konsequenzen zu ziehen. Stéphane Kezza kritisiert jedoch die Aussagen von La Voix des Sans Voix für Menschenrechte, die seinen Mandanten trotz Verbüßung seiner Strafe im Gefängnis sehen will.
„Anlässlich der Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Ermordung von Floribert Chebeya hat die Stimme der Stimmlosen einige Forderungen gestellt, darunter die Aufrechterhaltung der Haft von Oberst Daniel Moukalayi mit der Begründung, dass er die geeignete Person sei, um der Familie den Ort der Beerdigung von Fidèle Bazana zu zeigen. Aus der Sicht unseres Rechts gibt es keinen Grund, der es rechtfertigen könnte, eine Person, die ihre Verurteilung vollständig vollstreckt hat, weiterhin in Haft zu halten“, stellte Stéphane Kezza klar.
Er weist jedoch darauf hin, dass das Bedürfnis der Familie, den Ort von Fidèle Bazanas Grabstätte zu erfahren, ein legitimes Bedürfnis sei. Dennoch, so fährt er fort, gebe es keine rechtliche Rechtfertigung dafür, eine Person in Haft zu halten, nur weil Ermittlungen zur Ermittlung des Begräbnisorts laufen. „Es gab einen Prozess, es gab eine Razzia an der vermeintlichen Grabstätte, aber Oberst Muklalayi war nicht einmal an dieser Razzia beteiligt, da ihn den Beweisen in der Akte zufolge nichts mit dieser Operation in Verbindung brachte. Dass man ihm heute mit der Begründung, wir müssten den Ort dieser Beerdigung erfahren, in Haft halten muss, überrascht uns“, prangert Stéphane Kezza an.
Oberst Muklalayi wird weiterhin festgehalten, da sein formal anerkanntes rechtliches Festnahmedatum der 26. Juli ist, an dem der Haftbefehl für seine Festnahme ausgestellt wurde, erklärt seinerseits die Generalstaatsanwaltschaft der FARDC
(www.radiookapi.net)
DR Kongo: Die Koalition Unser Land ohne Öl bekräftigt ihren Widerstand gegen das Projekt zur Erforschung von 52 Ölblöcken
Die Koalition „Unser Land ohne Öl“ (NTSP) bekräftigte während einer Pressekonferenz am Montag, den 9. Juni, in Kinshasa ihre kategorische Ablehnung des Projekts zur Erkundung und Vergabe von 52 Ölfeldern im zentralen Becken der Demokratischen Republik Kongo.
Laut Serge Ngimbi, Koordinator der Initiative für lokale Entwicklung (IDEL/Boma), rechtfertigt die schlechte Regierungsführung, die im Kohlenwasserstoffsektor vorherrscht, diese harte Haltung. „Nach der Analyse der Regierungsführung im Ölsektor in der Demokratischen Republik Kongo haben wir verstanden, dass das Land die Kohlenwasserstoffe im Untergrund belassen und auf andere Weise weiter florieren kann. Die Art und Weise, wie Gott den Kongo geschaffen hat, verleiht ihm unschätzbare natürliche Ressourcen. Wir müssen an zukünftige Generationen denken und unser Ökosystem bewahren“, erklärte er.
Schutz des Kongobeckens
Er betont die strategische Bedeutung des Kongobeckens, zu dem die Demokratische Republik Kongo einen großen Anteil hat: 52 % der tropischen Wälder des Beckens, 62 % der Süßwasserressourcen und Torfgebiete, die für die globale Klimaregulierung unerlässlich sind. Für ihn bieten die Wälder des Kongobeckens weitaus mehr wirtschaftliche Vorteile als die Ölförderung.
„Im Vergleich dazu ermöglichte der mit PERENCO unterzeichnete Zusatzartikel 9 der Demokratischen Republik Kongo, über 20 Jahre hinweg lediglich 40 Millionen Dollar zu erwirtschaften, während die Wälder des Kongobeckens jährlich Hunderte Millionen Dollar generieren“, fügte er hinzu. Die Koalition „Unser Land ohne Öl“, die mehr als 150 zivilgesellschaftliche Umweltorganisationen vereint, setzt sich für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo ein und stellt den Erhalt der Waldökosysteme über die Ölinteressen
(www.radiookapi.net)
Mindestens 15.000 Einwohner von Walikale nach Kämpfen zwischen M23 und Wazalendo ohne Trinkwasser
Seit über einer Woche haben rund 15.000 Menschen in den Ortschaften Buleusa, Katrisa, Bushimba, Kilambo, Kibati und Kiteku im Walikale-Gebiet nach Kämpfen zwischen der M23 und Wazalendo keinen Zugang zu Trinkwasser.
Diese Situation ist die Folge der Zerstörung des Wasserauffang- und -verteilungssystems während der Kämpfe zwischen M23-Rebellen und Wazalendo-Kämpfern auf dem Mulema-Hügel, wo sich die Hauptquelle befindet. Die seit letzter Woche verschärften Zusammenstöße verhindern, dass technische Teams das Gebiet erreichen, um die Schäden zu begutachten und Reparaturen durchzuführen. Da ihnen das Trinkwasser fehlt, greifen Familien auf unbehandelte Wasserquellen zurück, was das Epidemierisiko erhöht.
Die lokalen Gesundheitseinrichtungen, die ebenfalls betroffen sind, haben Mühe, die grundlegende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Gesundheitsverantwortliche und zivilgesellschaftliche Akteure in diesem Teil des Landes schlagen Alarm und fordern dringende Maßnahmen, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser wiederherzustellen und eine größere Gesundheitskrise zu verhindern
(www.radiookapi.net)
Sexuelle Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo: MSF warnt vor einer weiterhin kritischen Situation
In der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) ist die Krise der sexuellen Gewalt weiterhin akut. Im Osten des Landes schlägt Ärzte ohne Grenzen (MSF) Alarm: Die Behandlung der Opfer ist nach wie vor unzureichend, während die Zahl der Übergriffe alarmierend hoch ist.
Zahlen, die eine anhaltende Notlage widerspiegeln
Im Jahr 2024 behandelten MSF-Teams allein in der Provinz Nord-Kivu fast 40.000 Opfer und Überlebende. Dieser Trend setzt sich fort: Zwischen Januar und April 2025 behandelte die Organisation rund 7.400 Menschen in Goma und mehr als 2.400 in Saké, etwa zwanzig Kilometer westlich der Stadt. Trotz der sich entwickelnden Sicherheitslage ist sexuelle Gewalt nach wie vor weit verbreitet. „Die Situation in dieser Region hat sich verändert, nicht jedoch das Problem der sexuellen Gewalt, deren Opfer vor allem Frauen sind“, erklärt François Calas, Programmmanager von MSF in Nord-Kivu.
Die Unsicherheit in diesen Konfliktgebieten heizt diese Gewalt weiterhin an. Die meisten gemeldeten Angriffe werden mit vorgehaltener Waffe verübt, die Angreifer bleiben aufgrund der Vielzahl bewaffneter Gruppen und der Verbreitung von Waffen oft unidentifiziert. MSF beklagt auch eine Verschlechterung des Zugangs zu medizinischer Versorgung. Viele Gesundheitseinrichtungen verfügen nicht mehr über die notwendigen Medikamente und Kits, um die Opfer zu behandeln. Die anhaltenden Konflikte unterbrechen die Versorgungsketten, während die Kürzung der humanitären Finanzierung die Situation weiter verschärft.
Ein intimes Leiden, das oft verschwiegen wird
Die in den folgenden Berichten verwendeten Vornamen wurden geändert, um die Anonymität der Opfer zu wahren. Die von MSF gesammelten Berichte verdeutlichen die Brutalität der Übergriffe und den Mangel an sicheren Orten für Frauen, egal ob Vertriebene oder ansässige Personen. „Bewaffnete Männer drangen gegen 22:30 Uhr in unser Haus ein“, sagt Nasha, eine vertriebene Frau, die auf einem Schulhof Zuflucht suchte. „Einige Ehemänner wurden getötet, einige Frauen vergewaltigt. So auch in meinem Fall. Drei Männer wollten mich vor den Augen meines Mannes und meiner acht Kinder vergewaltigen. Mein Mann wehrte sich. Sie töteten ihn“. In den Außenbezirken von Goma und Saké berichten weitere Opfer von Angriffen auf Straßen oder Feldern. „Sie forderten mich auf, mich zu entscheiden, ob ich ihnen meinen Körper überlasse oder getötet werde“, berichtet Rika, die in einem Dorf etwa 40 km westlich von Goma lebt.
„Sie haben mich vergewaltigt, einer nach dem anderen“
In Süd-Kivu ist die Lage nach wie vor ebenso besorgniserregend. In den Gebieten Kalehe und Uvira wurden seit Januar 2025 fast 700 Überlebende betreut. Auch hier kommt es häufig zu Übergriffen auf Reisen oder in der Nähe von Gesundheitseinrichtungen. „Wir haben auf den Feldern gelitten, auf denen wir Zuflucht gefunden haben“, bezeugt eine Bewohnerin der Hügel um Kamanyola. „Die bewaffneten Männer erlaubten uns nicht, die Dörfer zu durchqueren. Einige Frauen wurden sogar vergewaltigt, als sie versuchten, eine Gesundheitseinrichtung zu erreichen“.
Ärzte ohne Grenzen betont, dass die gemeldeten Zahlen weiterhin zu niedrig angesetzt sind. Laut Luders Leriche, medizinischem Koordinator in Süd-Kivu, halten Angst vor Repressalien, Stigmatisierung, Distanz und die Schwäche des Gesundheitssystems viele Opfer davon ab, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die sozialen und psychischen Folgen sind schwerwiegend: Isolation, Ablehnung und Selbstmordgedanken. Obwohl Frauen die Hauptopfer sind, sind auch Männer betroffen, obwohl die Zahl der gemeldeten Fälle deutlich geringer ist.
Ärzte ohne Grenzen ruft zu dringendem Handeln auf: „Trotz der aktuellen Herausforderungen dürfen wir diese Frauen und Kinder nicht im Stich lassen. Ihre Versorgung muss absolute Priorität haben“, betont François Calas. In den Provinzen Nord- und Süd-Kivu bietet Ärzte ohne Grenzen umfassende Versorgung an, darunter vorbeugende Behandlungen gegen sexuell übertragbare Infektionen, Notfallverhütung, Impfungen, psychologische Betreuung, sichere Schwangerschaftsabbrüche und Krankenhausaufenthalte in den schwersten Fällen. Doch ohne besseren Schutz der Zivilbevölkerung und einen nachhaltigen Zugang zur Gesundheitsversorgung droht sich die Notlage weiter hinzuziehen.
Ärzte ohne Grenzen fordert daher, die humanitären Bemühungen fortzusetzen oder sogar zu verstärken und die Opferbetreuung trotz globaler Mittelkürzungen wieder in den Mittelpunkt zu rücken
(actualite.cd)