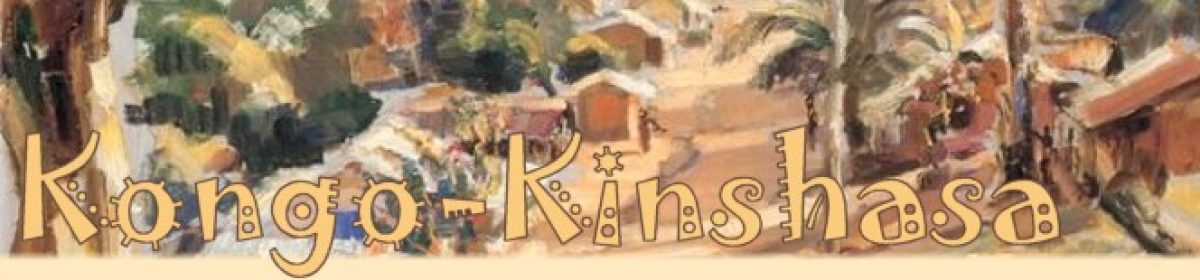DR Kongo: Kinshasa von Cholera-Epidemie betroffen, MSF schlägt Alarm
Seit Mai dieses Jahres herrscht in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) offiziell eine nationale Cholera-Epidemie. Seit Beginn des Jahres 2025 wurden fast 30.000 Fälle gezählt. Obwohl bisher mehrere Provinzen betroffen waren – die beiden Kivus, Tanganyika und Tshopo – hat die Krankheit nun auf einige städtische Gebiete der Stadt Kinshasa übergegriffen, wo ein Anstieg der Fälle die Gesundheitsbehörden beunruhigt.
Laut dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit (INSP) wurden in Kinshasa seit Januar insgesamt 136 Fälle registriert, darunter mehr als 90 in den letzten Wochen, sowie rund zwanzig Todesfälle. Elf der dreiundzwanzig Gesundheitszonen der Hauptstadt sind betroffen. Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat bereits ein Cholera-Behandlungszentrum in der Stadt eingerichtet und arbeitet an der Eröffnung einer zweiten Einrichtung. Für Stéphane Goetghebuer, Leiter der Mission von MSF Belgien in der Demokratischen Republik Kongo, geht die Ausbreitung der Epidemie in Kinshasa „offensichtlich vom Rest des Landes aus. Sie breitet sich allmählich aus, daher ist es nicht überraschend, dass die Stadt betroffen ist“.
Benachteiligte Viertel stärker gefährdet
In Kinshasa trifft die Cholera zuerst die am stärksten benachteiligten Viertel, insbesondere in hochwassergefährdeten Gebieten. „Betroffen sind vor allem die benachteiligten Viertel, die von Überschwemmungen betroffen sind, die manchmal durch Flüsse verursacht werden, die sich in überlaufende Abwasserkanäle verwandeln“, erklärt Stéphane Goetghebuer. Die Situation wird durch die späte Regenzeit noch verschärft. „In Kinshasa gab es kürzlich starke Regenfälle, obwohl die Trockenzeit eigentlich früher hätte beginnen sollen. Das spielt natürlich eine Rolle, aber es geht auch um Hygiene und Lebensbedingungen“, fährt er fort. Die Übertragung von Cholera, die durch das Bakterium Vibrio cholerae verursacht wird, ist eng mit Hygiene und dem Zugang zu sauberem Trinkwasser verbunden. „Sobald das Bakterium mit dem Mund oder den Schleimhäuten in Berührung kommt, oft über die Finger, kann es zu einer Infektion kommen“, erklärt der NGO-Leiter.
(www.rfi.fr)
Haut-Katanga bereitet sich auf den Start der Impfung von Kindern gegen Malaria vor
Das Nationale Malaria-Kontrollprogramm wird in Kürze Kinder im Alter von drei bis neunundfünfzig Monaten in Haut-Katanga impfen. Dies gab eine Delegation des Nationalen Gesundheitsministeriums am Mittwoch, dem 25. Juni, bei einem Besuch in Lubumbashi dem kommissarischen Gesundheitsminister der Provinz bekannt.
Ziel dieser Impfkampagne ist die Bekämpfung von Malaria, der viele Kinder dieser Altersgruppe zum Opfer fallen. „Im Rahmen dieser Intervention verabreichen wir unseren Kindern im Alter von drei bis 59 Monaten ein Molekül namens Ciphotaxin-Purimetanin und Amodiaquin. Diese Verabreichung ist Teil unserer präventiven Maßnahmen im Kampf gegen Malaria“, erklärt Dr. Guy Esebe, stellvertretender Direktor des Nationalen Malaria-Kontrollprogramms. Die Provinz Haut-Katanga wurde seiner Ansicht nach ins Visier genommen, weil sie einem Sahelklima ähnelt, in dem es eine lange Trockenzeit gibt. Darauf folgt eine Regenzeit mit intensiven Niederschlägen, die im September und Oktober beginnt. In dieser Zeit kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Malariafälle und Todesfälle bei Kindern im Alter von 3 bis 59 Monaten.
Deshalb hat das Malaria-Kontrollprogramm in Zusammenarbeit mit seinen Gebern bei der WHO „eine sehr wichtige Intervention in das Präventionspaket aufgenommen, die wir SMCI nennen. Sie wird mindestens 75 % unserer Kinder vor Malaria schützen. Bei der Umsetzung der Intervention konzentrieren wir uns auf sechs Gesundheitszonen, da es sich um eine Pilotphase handelt“. Der Impfstoff R21/Matrix-M ist so konzipiert, dass er auf das Sporozoitenstadium des Plasmodiums abzielt, das durch Mückenstiche auf den Menschen übertragen wird. In dieser Anfangsphase ist der Impfstoff am wirksamsten, da er die wenigen Sporozoiten von 10 bis 100 bekämpft, die in den Blutkreislauf gelangen, bevor sich der Parasit vermehren kann, erklärt die WHO.
(www.radiookapi.net)
Krankenhauszentrum in Butembo Opfer eines bewaffneten Angriffs
Das La Providence Hospital in Vukonderya in der Gemeinde Bulengera in Butembo war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 25. Juni, Ziel eines bewaffneten Überfalls. Zwei bewaffnete Banditen drangen in die Einrichtung ein und lösten Panik unter Patienten, Pflegekräften und Betreuern aus.
Sie stahlen Mobiltelefone und schätzungsweise 100.000 kongolesische Francs (35 US-Dollar). Laut John Paluku Kameta, dem Präsidenten der lokalen Zivilgesellschaft, versuchten die Täter zudem, ein minderjähriges Mädchen zu entführen und setzten ihre Machenschaften in benachbarten Häusern fort. Er forderte die Behörden auf, die Sicherheit rund um die Gesundheitseinrichtungen zu verstärken. Die lokalen Behörden kündigten die Einleitung einer Untersuchung in diesem Fall an.
(www.radiookapi.net)
DR Kongo: OCHA-Chef Tom Fletcher fordert in Goma: „Wir müssen großzügiger sein“
Der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten warnt die internationale Gemeinschaft vor der Verschlechterung der humanitären Lage im Osten der Demokratischen Republik Kongo, die durch den Konflikt zwischen der kongolesischen Armee und der AFC-M23-Rebellion verursacht wird.
Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo wurde Tom Fletcher nach eigenen Angaben Zeuge des Leidens der von Epidemien betroffenen Bevölkerung und der Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Tom Fletcher, der gestern, Mittwoch, in Goma eintraf, besuchte humanitäre Projekte für die Rückkehrer in Minova und Shasha in Nord- und Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo.
„Der Bedarf ist derzeit enorm. Bei meinen Besuchen in den letzten Tagen habe ich Vertriebene und sehr schutzbedürftige Menschen gesehen – auch Frauen, die Opfer sexueller Gewalt sind. Er warnte außerdem vor den Risiken von Cholera- und Mpockenepidemien und richtete einen Appell. „Ich befürchte, dass (die Situation) sich verschlechtert, weil der Konflikt sehr hart war, vor allem für die Zivilbevölkerung. Und deshalb müssen alle das internationale Recht und die Menschenrechte respektieren, die für unsere Antwort zentral sind. Was ich der internationalen Gemeinschaft sage, ist, dass man präsent bleiben muss, denn diese Krise ist enorm. Der Preis, den die Zivilisten zahlen müssen, ist sehr hoch und wir müssen großzügiger sein (als internationale Gemeinschaft).“
Zur Erinnerung: Die Vereinten Nationen kündigten Mitte Juni angesichts der „schlimmsten finanziellen Kürzungen“ der Geberländer, insbesondere der Vereinigten Staaten, eine drastische Kürzung der humanitären Hilfe an. Diese Entscheidung wird die ohnehin prekäre Lage von zig Millionen Menschen in diesem Jahr noch weiter verschärfen.
Laut OCHA, der Koordinierungsagentur der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, wurden bisher nur 5,6 Milliarden der ursprünglich beantragten 44 Milliarden US-Dollar – also 13 % der Gesamtsumme – aufgebracht, obwohl das Jahr bereits zur Hälfte vorbei ist und sich die humanitären Krisen vervielfacht haben: unter anderem im Sudan, Gaza, der Demokratischen Republik Kongo, Burma und der Ukraine.
Der gesamte globale humanitäre Sektor ist durch die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die US-Entwicklungshilfe zu beenden oder zu reduzieren, in Aufruhr geraten, berichtet Agence France-Presse.
(www.rfi.fr)
Obasanjo wird von Tshisekedi vor dem Friedensabkommen zwischen Kinshasa und Kigali empfangen
Der ehemalige nigerianische Präsident Olusegun Obasanjo reiste am Mittwoch, dem 25. Juni, diskret nach Kinshasa in die Demokratische Republik Kongo. Er, der als afrikanischer Vermittler bei der Lösung des bewaffneten Konflikts im Osten der Demokratischen Republik Kongo fungiert, wurde laut einer dem kongolesischen Präsidenten nahestehenden Quelle zwei Stunden lang von Präsident Félix Tshisekedi empfangen. Das Treffen fand 48 Stunden vor der geplanten Unterzeichnung eines Friedensabkommens in Washington durch die Außenminister der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas unter der Schirmherrschaft der USA statt.
Das Treffen zwischen Präsident Félix Tshisekedi und dem ehemaligen nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo dauerte zwei Stunden. Es sei ein „diskreter Last-Minute-Besuch“ gewesen, so eine Quelle aus dem kongolesischen Präsidentenamt. Nach dem Treffen erklärte Olusegun Obasanjo: „Wir prüfen alle Möglichkeiten hinsichtlich der Situation zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo, um weitere militärische Konfrontationen und Gewalt zu vermeiden“. „Die Gespräche, die ich mit meinen beiden Brüdern aus Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo geführt habe, verlaufen auf dem richtigen Weg“, fügte er hinzu. Am Vortag hatte sich das ehemalige Staatsoberhaupt in Kigali mit Präsident Paul Kagame getroffen.
Nächste Station seiner Mission: Lomé
Olusegun Obasanjo ist einer von fünf afrikanischen Vermittlern, die von der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) und der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) beauftragt wurden, zur Lösung der Krise im Osten der Demokratischen Republik Kongo beizutragen. Die nächste Station seiner Mission ist Lomé in Togo, wo er mit Präsident Faure Gnassingbé, dem von der Afrikanischen Union ernannten Vermittler, zusammentreffen soll. Sein Ziel: ihm Bericht zu erstatten, erklärte er, „um zu sehen, was für einen dauerhaften Frieden in der Region getan werden muss“. Ein Zeichen dafür, dass die afrikanische Diplomatie weitergeht, denn die Demokratische Republik Kongo und Ruanda werden morgen in Washington unter der Schirmherrschaft der Vereinigten Staaten ein Friedensabkommen unterzeichnen. Zu diesem Thema sagte der ehemalige Präsident Obasanjo, er schätze „alle laufenden Friedensinitiativen, ob von den Vereinigten Staaten oder Katar“.
(www.rfi.fr)
Angriffskrieg: CAFDHP erklärt sich für zuständig, um Ruanda zu urteilen
Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker (ACFDHP) erklärte sich am Donnerstag, dem 26. Juni, für zuständig, Ruanda im Verfahren gegen die Demokratische Republik Kongo anzuklagen.
Bei seiner Anhörung am Donnerstag während seiner 77. ordentlichen Sitzung in Arusha, Tansania, erklärte er die Beschwerde der Demokratischen Republik Kongo gegen ihren Nachbarn für zulässig und wirft ihm Aggression und schwere Menschenrechtsverletzungen im Osten des Landes vor. Kinshasa wirft Kigali insbesondere Grenzverletzungen und Massaker in Nord-Kivu seit 2022 vor. Die ruandische Verteidigung lehnte die Zuständigkeit des Gerichtshofs für diesen Fall ab. Der Gerichtshof lehnte diese Position jedoch ab. Er kündigte außerdem die Einleitung von Ermittlungen in der Angelegenheit an.
Das CAFDHP gewährte Ruanda 90 Tage Zeit, um seine Stellungnahme zur Sache einzureichen. Die Demokratische Republik Kongo hat 45 Tage Zeit, um zu antworten, bevor das Gericht seine Entscheidung in der Sache öffentlich bekannt gibt. Vor Ort in Arusha bezeichnete Interimsjustizminister Samuel Mbemba die Entscheidung als „Sieg für die Führung von Präsident Félix Tshisekedi, der die Liste früherer diplomatischer und wirtschaftlicher Erfolge über Ruanda ergänzt“. Elf Urteile, darunter das Urteil zum Streit zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, wurden während dieser Anhörung in Anwesenheit von elf Richtern des Gerichtshofs verkündet. Alle Richter sind Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union.
(www.radiookapi.net)
DR Kongo: 176 Organisationen verurteilen die Eröffnung neuer Ölblöcke im Kongobecken
Die Koalition „Unser Land ohne Öl“, die 176 kongolesische und internationale Organisationen vereint, verurteilt in einer Pressemitteilung die Eröffnung von 52 neuen Ölblöcken im Kongobecken. Diese Entscheidung wurde von der kongolesischen Regierung am 2. Mai 2025 angekündigt, zu einer Zeit, in der die Demokratische Republik Kongo ihre Ambitionen bekundet, ein Hauptakteur im Kampf gegen den Klimawandel zu werden. Für die Koalition ist die Wiederaufnahme von Ölexplorationsprojekten in einem geschützten Gebiet des Zentralbeckens „unverständlich und untragbar“.
Wenig überraschend prangern zivilgesellschaftliche Organisationen die erheblichen Folgen der Ölförderung für die Artenvielfalt, das Klima und die lokale Bevölkerung an – insbesondere, da es Alternativen gibt. „Ein weiteres enormes Umweltrisiko, obwohl es tatsächlich grüne Alternativen gibt, die man nutzen kann“, sagt Emmanuel Moussouyou von der NGO Corap, einem Mitglied der Koalition. “ Worum geht es, wenn man von grünen Alternativen spricht? Die DR Kongo verfügt über ein Wasserkraftpotenzial von mehr als 100.000 Megawatt. Sie verfügt auch über eine recht hohe Sonneneinstrahlung, die sie als Weltmarktführer für grüne Energien und all diese Initiativen positionieren könnte. Das wäre positiv für das ganze Land“, fügt Emmanuel Moussouyou hinzu.
Umstrittene wirtschaftliche Auswirkungen
Er stellt auch die wirtschaftlichen Vorteile der Ölförderung für die lokale Bevölkerung infrage: „Seit über 30 Jahren fördern wir im Westen des Landes, insbesondere in Muanda, Öl. Die Frage, die wir uns heute stellen, lautet: Was hat das Öl zur wirtschaftlichen Entwicklung des Gebiets von Muanda beigetragen? Sie werden feststellen, dass leider fast 95 % der Bevölkerung von Muanda keine Arbeit haben“. Mit dieser Aktionswoche hofft die Koalition „Unser Land ohne Öl“, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen und die Regierung zu überzeugen.
(www.rfi.fr)
Der Tag, an dem die Exporte von kongolesischem Kobalt wieder aufgenommen werden …
Die Demokratische Republik Kongo, die weltweite Nummer eins in der Produktion von Kobalt, einem Mineral, das in Autobatterien verwendet wird, hat ihr Exportverbot um drei Monate verlängert. Die Branche blickt jedoch bereits auf die Zeit danach und spekuliert über die Modalitäten einer Wiederaufnahme, da kongolesisches Kobalt so unumgänglich ist.
Die Demokratische Republik Kongo hat sich bis zum 21. September Zeit für eine Entscheidung gegeben, könnte sich aber schon vor Ablauf dieser Frist melden. Die Frage ist natürlich, wie lange das Land durchhalten kann: Kobalt ist eine wichtige Ressource für die Finanzen der kongolesischen Regierung, und die fehlenden Kobalt-Lizenzgebühren werden sich irgendwann bemerkbar machen. Die nationalen Vorräte haben sich in den letzten vier Monaten angehäuft und werden voraussichtlich weiter wachsen. Doch niemand weiß, ob die Demokratische Republik Kongo versucht, den Markt vollständig auszutrocknen, bevor sie die Schleusen wieder öffnet, oder ob sie einfach wartet, bis die Preise ein als zufriedenstellend erachtetes Niveau erreichen.
Morgen eine Exportquote?
Offiziell bleiben alle Türen offen. Die DR Kongo könnte das Exportverbot also noch verlängern, aber das ist nicht die bevorzugte Hypothese. Analysten halten es für wahrscheinlicher, dass die Exporte schrittweise wieder aufgenommen werden, da der Markt sonst mit Kobalt überschwemmt werden könnte, was für die Preise eine Katastrophe wäre.
Die Festlegung einer Produktionsquote erscheint nicht praktikabel, da Kobalt in den Minen der Demokratischen Republik Kongo in gleicher Menge gefördert wird wie das dazugehörige Kupfer. Eine Exportquote könnte eine Lösung sein, würde aber die Herausforderung mit sich bringen, den Abfluss des Landes streng zu kontrollieren. Dies könne „kostspielig und ineffizient sein“, betont Jack Bedder von Project Blue.
Nach Ansicht von Chris Welch, Kobaltmarktanalyst bei Argus Media, besteht die einzige nachhaltige Lösung in der Schaffung eines ausgeglichenen Marktes mit stabilem Angebot und starker Nachfrage. Derzeit ist keines dieser Kriterien erfüllt.
Entmutigte Hersteller?
Die fehlende Möglichkeit, kongolesisches Kobalt zu importieren, und der Preisanstieg könnten darauf hindeuten, dass Hersteller versuchen, von Kobalt abzurücken. Kurzfristig dürfte die aktuelle Situation die Nachfrage jedoch nicht belasten. Kobalt macht weniger als 5 % der Kosten einer konventionellen Batterie aus, sodass ein Preisanstieg die Produktionskosten nicht wesentlich beeinflussen wird, fasst Thomas Matthews, Analyst für Batteriematerialien bei der CRU Group, zusammen.
Kobaltfreie Batteriealternativen begannen sich bereits vor dem Exportverbot ihres Erzes durch die Demokratische Republik Kongo zu entwickeln. Ein Paradebeispiel ist die LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat), die in China im Elektroautosektor weitverbreitet ist. Ein weiterer Faktor, der einen radikalen Wandel nicht unterstützt, ist die Tatsache, dass die Kobaltproduktion größtenteils auf langfristigen Verträgen basiert, erklärt Thomas Matthews. Hinzu kommt, so der Experte der CRU Group, dass einige Batteriehersteller wie CATL an Kobaltminen beteiligt sind: Der weltweit führende Batteriehersteller hält Anteile an CMOC, dem größten Bergbauunternehmen der Branche, sowie eine direkte Beteiligung an KFM, der weltweit größten Kobaltmine in der Demokratischen Republik Kongo.
(www.rfi.fr)