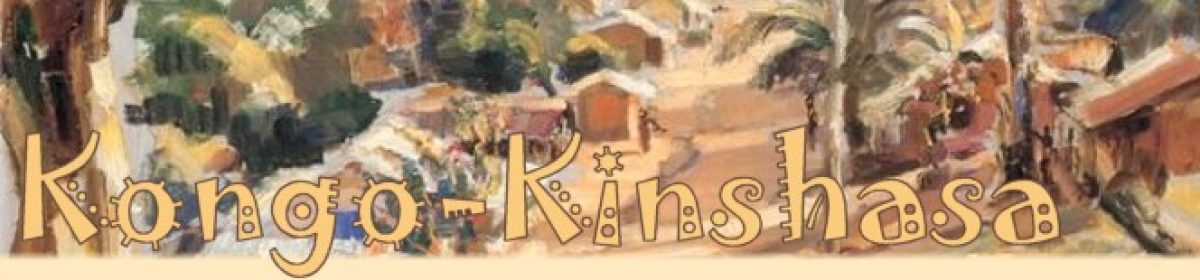Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist nach den Kämpfen in Uvira die Zeit der Rückkehr gekommen
Burundische Zivilisten kehren unter M23-Schutz in ihr Heimatland zurück
Mit gezückten Waffen stehen sich burundische Soldaten und M23-Milizionäre am Grenzübergang Kavimvira zwischen der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Burundi gegenüber. „16.12.2025“ weiterlesen